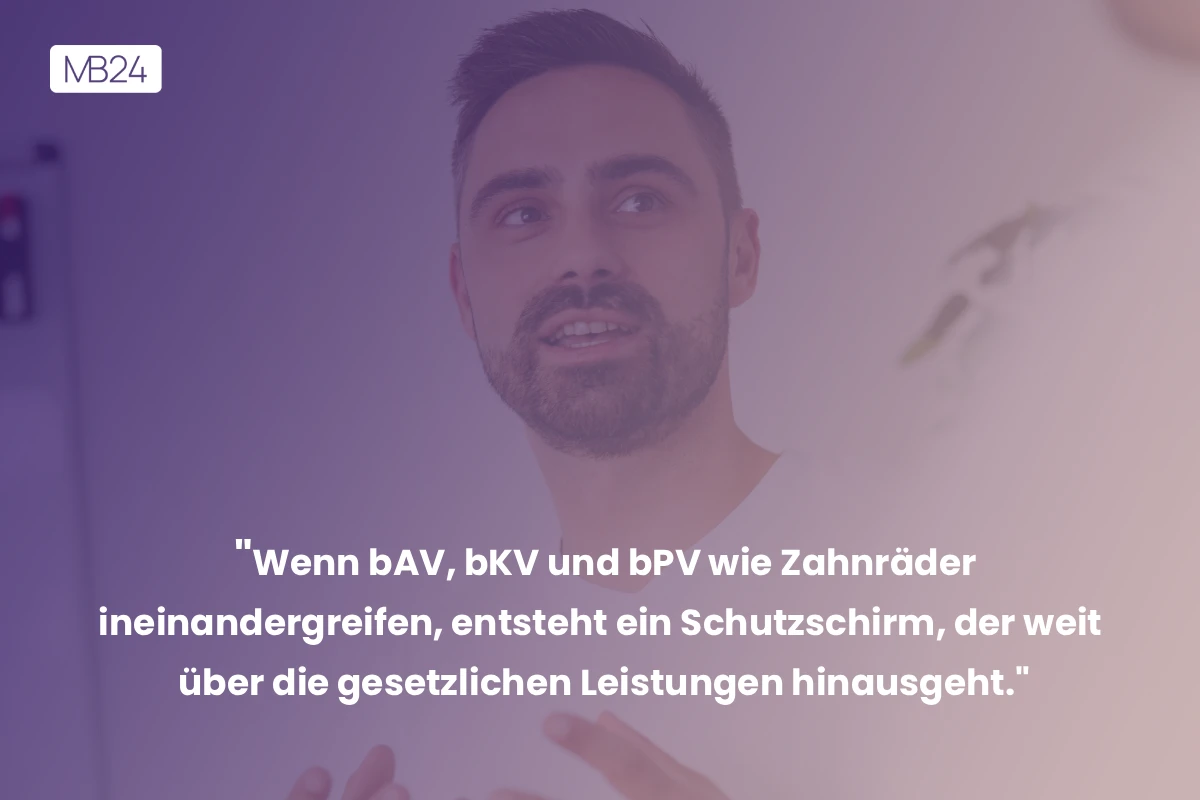Ein Abend zwischen Spätschicht und Sorgen
Es ist kurz nach 19 Uhr, als Caro (46) ihre Wohnungstür hinter sich schließt. Der Tag war lang, doch die Nachricht der Pflegedienstleiterin ihrer Mutter wiegt schwerer als jede Schicht: Der Eigenanteil im Pflegeheim steigt ab August um weitere 290 Euro im Monat. Caro verdient ordentlich als Schichtleiterin – aber seit der letzten Erhöhung reicht ihr Netto kaum noch für Miete, Lebenshaltungskosten und die Pflegekosten.
„Ich dachte, dafür gibt es doch die Pflegekasse“, sagt sie fassungslos. Erst jetzt versteht Caro, was Millionen Familien bereits schmerzhaft erleben: Die gesetzliche Pflegeversicherung ist keine Vollversicherung. Sie deckt nur einen Teil der Kosten – den Rest tragen Betroffene und Angehörige selbst.
Das stille Kostenbeben - wie groß die Pflegelücke 2025 wirklich ist
Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen. Ende 2024 meldete das Statistische Bundesamt rund 5,6 Millionen Pflegebedürftige - das sind fast 400.000 mehr als im Vorjahr (Destatis). Bis 2055 rechnen Experten mit bis zu 7,6 Millionen Fällen, also einem Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegenüber 2021.
Doch nicht nur die Zahl der Betroffenen steigt, sondern auch die Finanzierungslücke der gesetzlichen Pflegeversicherung wächst dramatisch. Der Bundesrechnungshof warnt, dass der sozialen Pflegeversicherung (SPV) schon 2026 bis zu 3,5 Milliarden Euro fehlen könnten. Bis 2029 könnte sich das Defizit sogar auf 12,3 Milliarden Euro summieren (Bundesrechnungshof-Bericht, 2024).
Um gegenzusteuern, hat die Bundesregierung den Beitragssatz zum 1. Januar 2025 auf 3,6 Prozent angehoben. Kinderlose zahlen durch den Zuschlag sogar 4,2 Prozent. Laut Bundesrat bringt das rund 3,7 Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr (bundesrat.de). Doch diese zusätzlichen Gelder reichen nicht, um das strukturelle Loch zu stopfen.
Also: Die Pflegelücke ist 2025 keine Zukunftsangst mehr, sondern eiskalte Realität. Mehr Menschen benötigen Pflege, die Kosten steigen schneller als die Beiträge, und die gesetzliche Pflegeversicherung kann nur einen Bruchteil abfangen.

Mehr zahlen, weniger bekommen - die Eigenanteile klettern
Pflege ist teuer - und die Schere zwischen dem, was die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt, und dem, was Betroffene selbst zahlen müssen, öffnet sich jedes Jahr weiter.
Wer heute in ein stationäres Pflegeheim zieht, zahlt laut einer IGES-Studie im bundesweiten Schnitt rund 3.108 Euro Eigenanteil pro Monat (Pflegia Magazin). Aufs Jahr gerechnet entspricht das fast 37.300 Euro, die weder durch eine durchschnittliche Rente noch durch ein mittleres Einkommen gedeckt werden können.
Die seit 2022 eingeführten Entlastungszuschläge (§ 43c SGB XI) reduzieren zwar die Kosten für Pflegebedürftige, doch sie haben eine Schattenseite: Sie belasten die Sozialkassen zusätzlich. Schon 2024 beliefen sich diese Zuschüsse auf 6,4 Milliarden Euro. Bleibt die Entwicklung unverändert, könnten es bis 2035 über 11,7 Milliarden Euro werden (PKV-Verband).
Der bekannte Finanzratgeber Finanztip fasst es nüchtern zusammen: „Die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung. Wer mehr einzahlt, bekommt nicht automatisch mehr heraus – die privaten Kosten steigen deutlich schneller als jede Beitragserhöhung.“ (Finanztip.de)
Für Betroffene bedeutet das: Je länger ein Pflegefall andauert, desto größer wird die finanzielle Lücke. Gerade Familien mit mittlerem Einkommen stehen dadurch oft vor existenziellen Problemen – trotz jahrelanger Einzahlung in die Pflegeversicherung.
Demografie trifft Arbeitswelt - und Pflege wird zum Chefthema
Pflege ist längst kein rein privates Problem. Laut Familienreport der Bundesregierung pflegt fast jede/jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland Angehörige – mit direktem Einfluss auf Arbeitszeit und Belastung.
Die Folgen für Arbeitgeber sind messbar: Fällt nur ein Prozent der Belegschaft dauerhaft aus, entstehen in einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden Kosten von durchschnittlich 1,2 Millionen Euro pro Jahr – verursacht durch Produktivitätsverluste, Wissensabfluss und zusätzliche Belastungen für die verbleibenden Teams.
Doch in dieser Entwicklung steckt auch eine Chance. Unternehmen, die das Thema Pflege frühzeitig aufgreifen, senden ein starkes Signal in den Arbeitsmarkt: Wir lassen unsere Mitarbeitenden nicht allein.
- Pflegefreundliche Arbeitszeitmodelle ermöglichen Flexibilität in Notsituationen.
- Entlastungsangebote wie Haushaltshilfen oder externe Care-Services zeigen Fürsorge.
- Zusätzliche Vorsorgebausteine wie betriebliche Pflegeleistungen oder BKV-Pflegeoptionen entlasten Mitarbeitende finanziell.
Das Ergebnis: geringere Fehlzeiten, weniger Fluktuation und eine deutlich stärkere emotionale Bindung an den Arbeitgeber. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird Pflege damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
Oder unser MB24-Mitgründer Benjamin Schifferer es auf den Punkt bringt:
„Pflege wird oft als Kostenfaktor diskutiert. In Wahrheit ist sie ein Bindungsfaktor erster Güte. Wer seine Mitarbeitenden in dieser Lebensphase unterstützt, gewinnt Loyalität – und ein unschlagbares Argument im War for Talent.“
Der rechtliche Rahmen & was Arbeitgeber heute schon müssen
Seit der Reform zum 1. Januar 2025 gilt: Pflege ist auch ein Arbeitsrechtsthema. Unternehmen können sich dem nicht entziehen, denn mehrere Gesetze verpflichten sie bereits heute, ihre Mitarbeitenden bei der Pflege von Angehörigen zu unterstützen.
1. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG)
Tritt eine akute Pflegesituation auf, dürfen Beschäftigte bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernbleiben. Das Gehalt zahlt in dieser Zeit nicht der Arbeitgeber, sondern die Pflegekasse in Form des Pflegeunterstützungsgeldes. Wichtig: Der Antrag kann noch am selben Tag gestellt werden – Ablehnung durch den Arbeitgeber ist rechtlich ausgeschlossen (betanet.de).
2. Pflegezeit (§§ 3–4 PflegeZG)
Mitarbeitende haben das Recht, sich bis zu sechs Monate teilweise oder vollständig von der Arbeit freistellen zu lassen, um einen nahen Angehörigen zu pflegen. Seit 2025 genügt dafür eine einfache Ankündigung in Textform, die spätestens zehn Arbeitstage vorher erfolgen muss. Während der Pflegezeit gilt ein umfassender Kündigungsschutz (buzer.de).
3. Familienpflegezeit (§§ 2–4 FPfZG)
Wer seine Arbeitszeit längerfristig reduzieren möchte, kann dies nun bis zu 24 Monate tun, solange die Wochenarbeitszeit mindestens 15 Stunden beträgt. Auch hier gilt Kündigungsschutz. Für kleinere Betriebe (unter 26 Beschäftigten) gelten Erleichterungen: Sie müssen Familienpflegezeit nicht gewähren, aber die kurzfristige Arbeitsverhinderung bleibt Pflicht.
Darüber hinaus schreibt § 167 SGB IX das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) vor: Beschäftigte, die länger als sechs Wochen krankheitsbedingt ausfallen, müssen ein strukturiertes Rückkehrgespräch erhalten. Gerade pflegende Angehörige fallen oft unter diese Regelung.
Deswegen brauchen Arbeitgeber klare Prozesse, Checklisten und feste Ansprechpartner, um die rechtlichen Vorgaben korrekt umzusetzen. Wer hier Fehler macht, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch Image-Schäden.
Oder wie MB24-Geschäftsführer Jannis Oberhaus es formuliert:
„Die Gesetze zwingen Unternehmen, das Minimum zu ermöglichen. Clevere Arbeitgeber aber denken größer: Sie kombinieren gesetzliche Freistellungen mit BKV-Pflegebausteinen, Pflegerenten in der bAV oder einer betrieblichen Pflegeversicherung. So wird Pflicht zur Kür – und Fürsorge zum echten Differenzierungsmerkmal.“