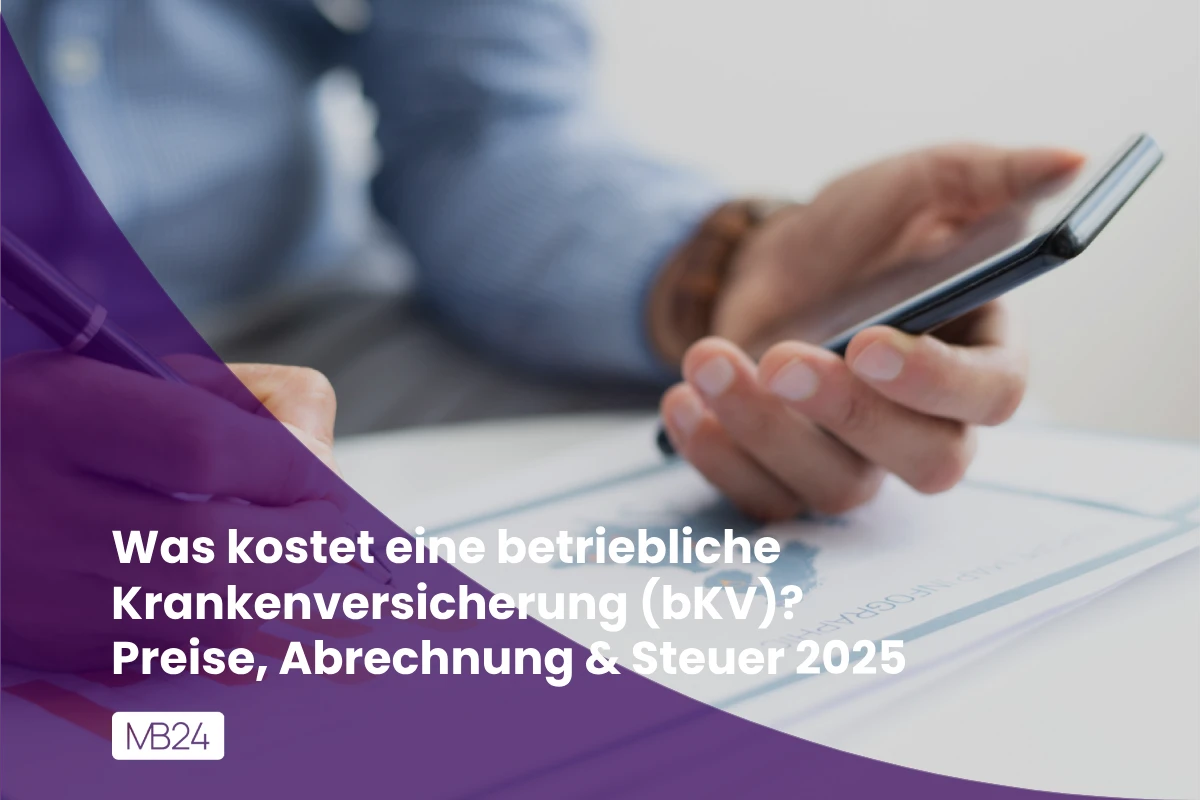Was kostet eine betriebliche Krankenversicherung (bKV)?
Montagmorgen, 09:05 Uhr. Produktionsleiterin Jana legt dem CFO die Krankenstandsstatistik vor: 6,1 % Ausfallquote, zwei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. In der anschließenden Diskussion fällt der Satz, der jede Budgetrunde bestimmt: „Eine betriebliche Krankenversicherung klingt gut – aber was kostet sie uns?“
Dass Kosten nicht gleichbedeutend mit Belastung sind, zeigt dieser Artikel. Er liefert konkrete Beträge, erklärt Abrechnung & Steuer und zeigt, wie Sie den Return-on-Investment (ROI) schon vor Vertragsunterschrift berechnen.
Warum Kosten nicht alles sind - die ROI-Perspektive
Wer den Preis einer bKV isoliert betrachtet, sieht nur die Ausgabenseite. Laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kostet ein einziger krankheitsbedingter Ausfalltag deutsche Betriebe im Schnitt 144 € an Lohnfortzahlung und Produktionsverlust . Selbst ein 35-Euro-Komforttarif amortisiert sich also, wenn er jährlich nur einen halben Fehltag pro Beschäftigtem verhindert.
Preisfaktoren einer bKV
Leistungsniveau und Beitragsspanne
Im Grunde lassen sich die bKV-Tarife in drei Preis- und Leistungsklassen einteilen:
- Basis-Pakete decken überwiegend zahn- und sehbezogene Leistungen ab, etwa – je nach Versicherer – eine professionelle Zahnreinigung pro Jahr sowie Zuschüsse zu Brille oder Kontaktlinsen. Die monatlichen Beiträge bewegen sich hier meist zwischen 12 und 18 Euro pro Mitarbeiter.
- Komfort-Pakete ergänzen die Zahnbausteine um ein Ambulant-PLUS-Modul. Das beinhaltet häufig einen Facharzttermin-Service, Erstattungen für Heil- und Hilfsmittel und – immer gefragter – einen telefonischen Psychosupport. Für dieses Leistungsniveau sollten Unternehmen mit 25 bis 40 Euro pro Monat rechnen.
- Premium-Pakete bieten alles aus der Komfortstufe und legen noch einen Pflege- oder Hospitaltagegeld-Baustein obendrauf. Dadurch schöpfen sie die steuerlich begünstigte 50-Euro-Sachbezugsgrenze fast vollständig aus; die Beiträge liegen üblicherweise zwischen 42 und 50 Euro pro Mitarbeiter und Monat.
Die meisten mittelständischen Unternehmen landen beim Komfortpaket – genug Mehrwert für die Belegschaft, ohne die steuerliche 50-Euro-Schwelle zu überschreiten. Laut PKV-Verband hatten Ende 2024 bereits 56 500 Unternehmen mindestens einen dieser Tarife für ihre Beschäftigten abgeschlossen, ein Wachstum von 30 % in nur zwölf Monaten.
Einfluss der Belegschaftsstruktur
Anders als bei einer privaten Vollversicherung spielt das Alter keine Rolle: Die bKV ist ein Kollektivvertrag. Kosten verändern sich eher durch Branchenrisiken (z. B. körperlich harte Arbeit → höhere Physiotherapieleistungen) oder eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage nach Zahnbausteinen.
Wer trägt die Beiträge – und warum das wichtig ist
In 95 % der Verträge zahlt der Arbeitgeber den vollen Beitrag. Diese Vollfinanzierung ist mehr als Großzügigkeit:
- Emotionale Bindung: Studien zeigen, dass Benefits ohne Eigenanteil doppelt so stark auf Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft wirken.
- Steuervorteil: Nur rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge bis 50 €/Monat gelten als Sachbezug und bleiben lohn- sowie sozialabgabenfrei (§ 8 Abs. 2 EStG) .
Mischmodelle mit Gehaltsumwandlung sind möglich, werden jedoch unter § 3 Nr. 63 EStG geführt: steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig.
Steuer- und Sozialabgaben: Die 50-Euro-Regel
Die Freigrenze funktioniert binär: 50,00 € sind steuerfrei, 50,01 € machen den gesamten Betrag steuer- und SV-pflichtig. Das BMF merkt ausdrücklich an, dass auch Inflationsklauseln oder spätere Tariferhöhungen den Vorteil gefährden können.
Praxistipp: Verhandeln Sie eine „Deckelgarantie“. Dabei garantiert der Versicherer, dass Beitragsindexierungen die 50-Euro-Grenze nicht überschreiten.
Abrechnung in der Praxis
- Sammelrechnung: Der Versicherer stellt eine Monatsrechnung über alle aktiven Köpfe.
- Payroll: HR verbucht den Betrag unter der Lohnart „Sachbezug bKV, steuerfrei“.
- Schnittstellen: Ein- und Austritte werden automatisiert gemeldet; dadurch zahlen Sie nie für ausgeschiedene Mitarbeitende.
- Leistungsreport: Ein anonymes Dashboard zeigt, wie viele Facharzttermine vermittelt, Rechnungen erstattet und Hotline-Minuten genutzt wurden.
Der administrative Mehraufwand sinkt auf wenige Minuten pro Monat, wenn eine HR-Schnittstelle existiert.
Wirtschaftlichkeitsrechnung – ein Mittelstandsbeispiel
Rahmendaten
- 160 Beschäftigte (130 Vollzeit, 30 Teilzeit)
- bKV-Komforttarif: 32 € pro Kopf und Monat
- Aktueller Krankenstand: 5,8 % ≈ 21 Arbeitsunfähigkeitstage (AU) pro Jahr
- Ø-Kosten eines AU-Tages laut BAuA 2024: 144 €
Schritt 1: Bruttokosten
32 € × 160 Mitarbeitende × 12 Monate = 61 440 €
Schritt 2: Fehlzeitersparnis ansetzen
Unternehmensziel: die bKV soll im ersten Jahr 0,6 AU-Tage pro Kopf einsparen.
0,6 Tage × 160 Mitarbeitende × 144 € = 13 824 €
Schritt 3: Fluktuationskosten reduzieren
In dieser Branche kostet der Ersatz einer Fachkraft (Suche, Onboarding, Minderleistung) im Schnitt 9 600 € (IAB-Studie 2024). Wenn der zusätzliche Gesundheitsbenefit nur eine Kündigung verhindert, spart das den vollen Betrag.
Schritt 4: Nettoaufwand ermitteln
61.440 € (Bruttobeitrag bKV)
- 13.824 € (Fehlzeitersparnis)
- 9.600 € (Fluktuationshebel, 1 gehaltene Fachkraft)
= 38.016 € Effektivaufwand in Jahr 1
Schritt 5: Break-even berechnen
- Monatliche bKV-Kosten: 32 € × 160 = 5 120 €
- Monatliche Fehlzeit-Ersparnis: 13 824 € / 12 = 1 152 €
- Einmalige Fluktuationsersparnis: 9 600 € (unterstellen wir in Monat 1)
Gleichung für Break-even:
5 120 € × m = 9 600 € + 1 152 € × m
5120–1152 × m = 9 600 → m ≈ 2,4 Monate
Das Unternehmen hat seine Investition nach knapp 3 Monaten wieder eingespielt.
Danach arbeitet jeder weitere Monat bis Jahresende mit rund 3 968 € positivem Saldo (5 120 € Kosten – 1 152 € laufende Einsparung).